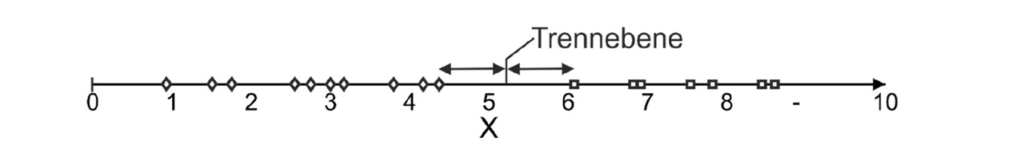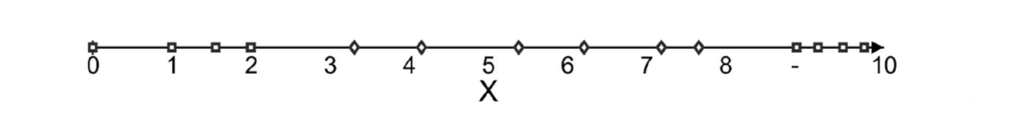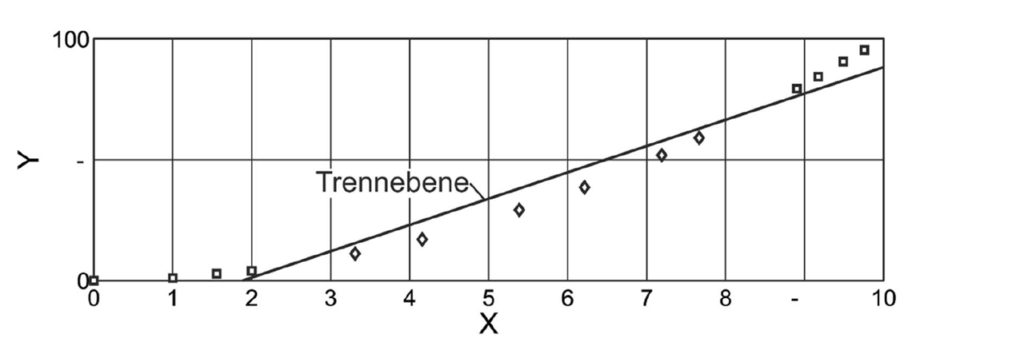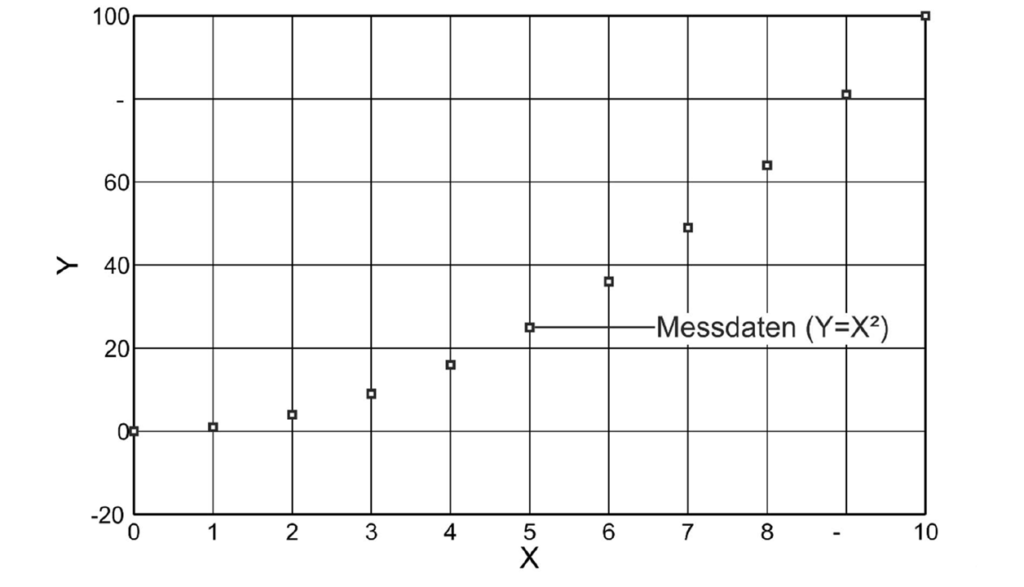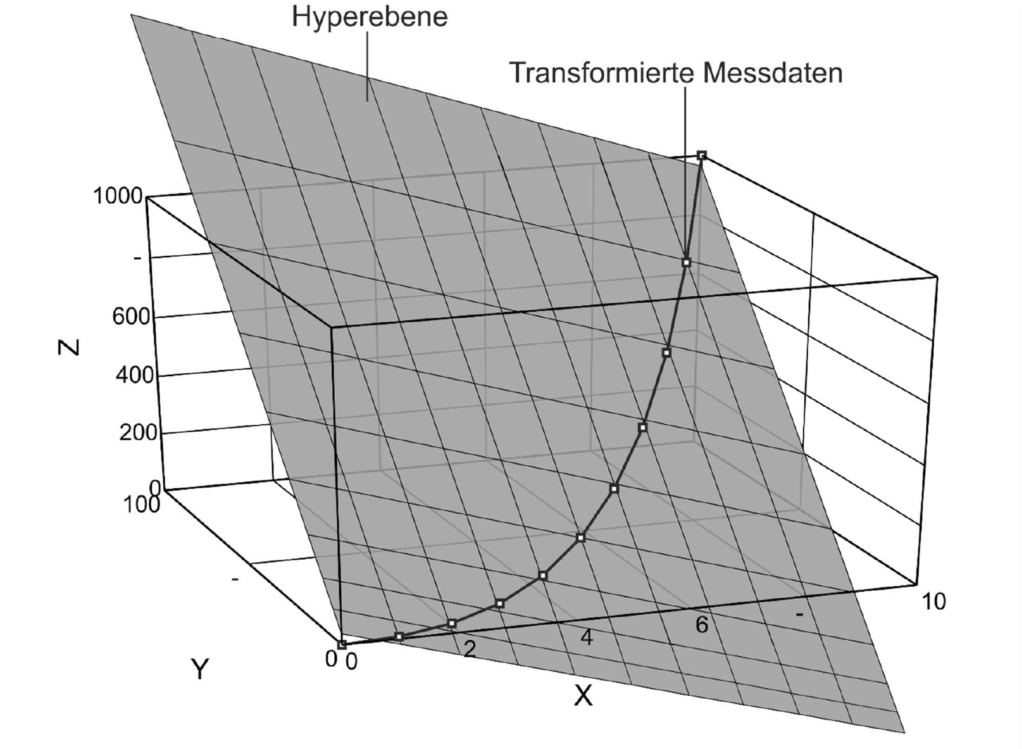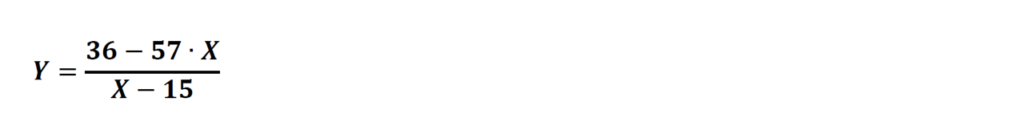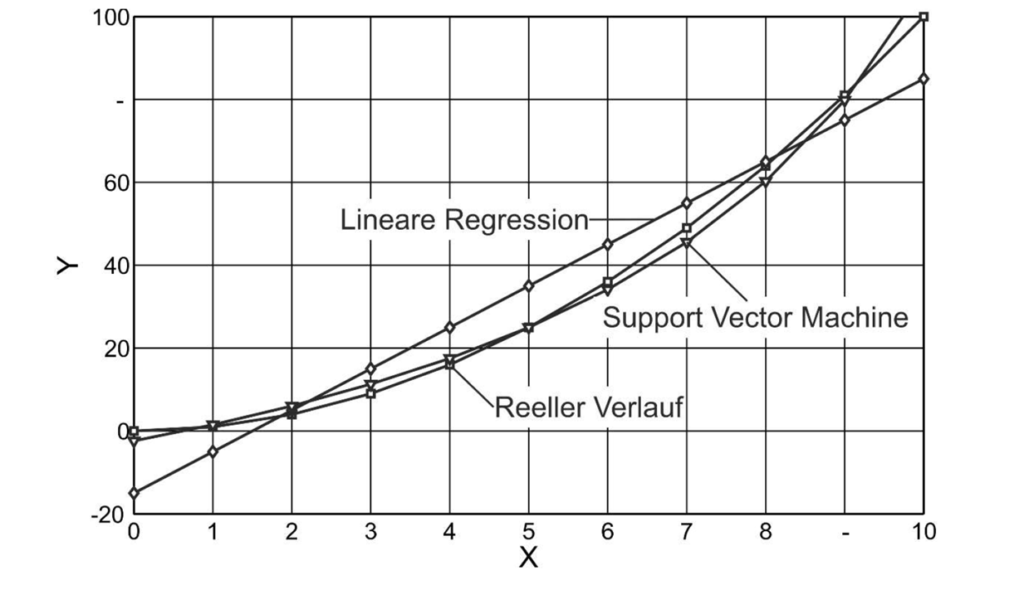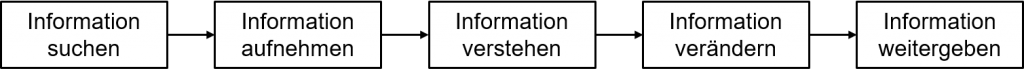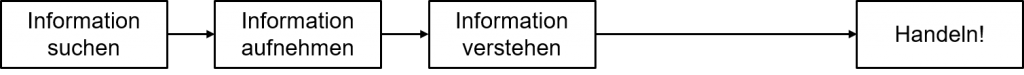Nach der Insolvenz von VanMoof drohen bereits gekaufte Fahrräder unbrauchbar zu werden. Der Heiseverlag weist in seinem Artikel vom 18.07.23 auf die drohende Gefahr hin: https://www.heise.de/hintergrund/VanMoof-ist-insolvent-Die-wichtigsten-Fragen-und-Antworten-9219435.html
Solche Momente werden wir bald häufiger erleben. Durch abgeschaltete Server werden Hightechprodukte zu teurem Elektroschrott. Und dafür braucht es nicht erst eine Insolvenz.
Es reicht aus, wenn ein Hersteller sich entscheidet ein Produkt nicht weiterzuführen oder er für ein Nachfolgeprodukt auf eine neue Technologie setzt. Dann stellt sich im Produktmanagement schnell die Frage wie lange die digitalen Dienste für die alten unliebsamen Produkte noch gepflegt werden müssen, verursachen diese doch hohe Kosten.
Bei Kleingeräten (z. b. im Smart-Home-Bereich) mag das Abschalten für den Kunden noch verschmerzbar sein, bei einem Fahrrad für über 1.000 Euro ist das schon ärgerlicher und bei einem Auto erst recht. Bei „älteren“ BMWs funktioniert z. B. das Connected Drive nicht mehr. Der Grund: Abgeschaltete Server nach einem Architekturwechsel. Das Resultat: Keine Echtzeitstauinformationen mehr und auch keine anderen Onlinefunktionen. Zum Glück fahren die Autos noch.
Was aber, wenn (wie bei VanMoof) die digitalen Dienste den Großteil des Funktionsumfangs ausmachen und wir über wirklich teure Produkte wie Maschinen und Anlagen sprechen? Werden diese dann zu einem „Wegwerfartikel“ so wie viele Consumer-Elektronikprodukte, die man ständig neukaufen muss, weil sie nicht mehr unterstützt werden?
Es mag sein, dass diese Vorstellung dem ein oder anderen Vertriebler ein Glitzern in die Augen zaubert, aber so verschwenderisch darf unsere Welt nicht werden. Offengesagt habe ich für das Problem auch keine allgemeine Lösung aber zwei Dinge sind mir wichtig:
- Liebe Produktmanager, erinnern Sie sich daran, dass der Produktlebenszyklus nicht mit der Produkteinführung endet, sondern mit der Abkündigung, wenn der Applaus über Ihre tollen neuen Funktionen längst verstummt ist. Wie lange können Sie die digitalen Dienste, mit denen Sie Ihr Produkt heute ausstatten aufrechterhalten? Bei einer Werkzeugmaschine kann die Nutzungsdauer schon mal 20 Jahren betragen. Haben Sie eine Exitstrategie, wenn Sie Ihre Dienste vorher abschalten müssen? Können Sie vielleicht Ihre Entwicklungen offenlegen, um diese in ein Opensourceprojekt zu überführen? Und muss überhaupt wirklich immer alles an der Cloud hängen?
- Liebe Anwender, seien Sie sich darüber im Klaren, dass Onlinedienste nun mal laufende Kosten bei den Herstellern verursachen, die bezahlt werden müssen. Sie mögen kostenlose Updates vielleicht von Ihren Büroprogrammen gewohnt sein, aber beachten Sie das die Maschinenhersteller nicht Microsoft und Co. heißen und sich die wenigsten davon einen langjährigen unbezahlten Softwaresupport leisten können. Verteufeln Sie daher die neuen Vergütungsmodelle wie Subscription und Co. sowie Wartungsverträge nicht voreilig. Sie sind unerlässlich, wenn Sie Ihre Maschine langfristig mit digitalen Diensten ausstatten wollen.